Interview mit Dr. Thomas Köthe
mit Wissenschaft zur Perfektion !?
Viele Wettkämpfe sind ohne Dr. Thomas Köthe und seine Videokamera gar nicht denkbar. Als Fachgruppenleiter Wasserspringen am Institut für Angewandte Trainingswissenschaft (IAT) in Leipzig hat er die Entwicklung im Wasserspringen national und international seit Jahren im Blick.
Monika Dietrich (M. D.): Hallo Thomas, schön dich wieder in der Rostocker Sprunghalle begrüßen zu können. Hast du eigentlich Erinnerungen an deine Zeit als aktiver Wasserspringer in der Neptunschwimmhalle?
Dr. Thomas Köthe (T. K.): Hallo Monika, ich freue mich immer, wenn ich hier nach Rostock kommen kann. Ja, ich war als aktiver Springer auch schon beim Internationalen Springertag dabei. Das war damals schon ein harter Wettbewerb innerhalb des Teams, um die Möglichkeit zu bekommen, an diesem schon immer hochwertigen Wettkampf teilzunehmen. Da war man unheimlich aufgeregt, die Sprünge sauber ins Wasser zu bringen. Aber ich hatte einen guten Trainer, der mich nicht nur zu Hause im Training geführt hat, sondern auch bei den Wettkämpfen hervorragend betreute. Uwe Fischer war zu meiner Zeit ein junger ehrgeiziger Trainer, dem ich wirklich viel zu verdanken habe. Er ist vor allem bekannt geworden als Trainer von Britta Baldus, Ute Wetzig, aber auch von Stefan Feck, Friedericke Freyer und anderen hervorragenden Leipziger Wasserspringern.
Die Atmosphäre in Rostock war schon immer besonders. Sie regte damals wie heute internationale Springer zu Höchstleistungen im und auch außerhalb des eigentlichen Wettbewerbs an.
Für mich als junger Springer waren die Begegnungen mit Springerinnen und Springern aus aller Welt während der Wettkämpfe immer ein großes Erlebnis. So erinnere ich mich an einen Auftritt von Phil Boggs, der in einer Wettkampfpause den Welt-Erstversuch eines 4 ½ Salto vorwärts gehockt vom 10-m-Turm wagte und erfolgreich absolvierte. In einer weiteren Pause zwischen den Wettkämpfen zeigte er auch noch den 3 ½ Delphinsalto gehockt, ebenfalls von der 10-m-Plattform. So etwas erlebte man eben nur in Rostock. Später wurden weitere Weltneuheiten beim "Springertag" gezeigt, wie z. B. der 3 ½ Auerbachsalto gehechtet, der 2 ½ Salto vorwärts mit drei Schrauben, der 3 ½ Delphinsalto gehechtet (alle vom 3-m-Brett), um nur die wichtigsten zu nennen, die mir wegen ihrer Außergewöhnlichkeit, ihrer Schwierigkeit und Präzision im Gedächtnis geblieben sind. In diesem Zusammenhang ist auch der Wagemut - nach gewissenhafter Vorbereitung natürlich - des Rostocker Springers Frank Sander hervorzuheben, der hier 2003 zum 48. Springertag in Rostock als erster Springer der Welt den 4 ½ Salto vorwärts gehockt vom 3-m-Brett im Wettkampf vorführte. Respekt allen diesen hervorragenden Springerinnen und Springern, die mit ihren Vorstößen die Welt des Wasserspringens bereichert und ihre Entwicklung vorangetrieben haben.

M. D.: In der Rostocker Neptunschwimmhalle hat sich in den letzten Jahrzehnten vieles verändert. Neues ist hinzugekommen und das eine oder andere wurde bewahrt. Trifft das im übertragenen Sinne auch auf das Wasserspringen zu?
T. K.: Ohne hier philosophisch werden zu wollen, trifft das natürlich auf alle Bereiche zu. Die Weiterentwicklung bei der Schwierigkeit der Sprünge hatte ich ja bereits angerissen. Dazu kommt die größere Leistungsdichte bei der Präzision der Sprungausführung. Wenn wir uns die Wettkampfformate anschauen, haben wir ein gutes Beispiel dafür, wie Bewährtes und Neues untrennbar miteinander verbunden sind. Die Basis waren, sind und bleiben immer die einzelnen Sprünge. Diese werden in den Sprungserien unterschiedlich kombiniert. Dafür gibt es die Kür, was soviel heißt wie Wahl oder Auswahl. Zu meiner aktiven Zeit waren noch Pflichtsprünge neben den Kürsprüngen zu absolvieren - für manchen schon mal der Scharfrichter -, dann kamen Sprünge mit begrenztem Schwierigkeitsgrad, die frei wählbar waren im Sinne einer Pflicht-Kür, wie wir sie heute noch in ähnlicher Form bei den Jugendwettkämpfen sehen.
Neues und Bewährtes nebeneinander!
Für mich als junger Springer waren die Begegnungen mit Springerinnen und Springern aus aller Welt während der Wettkämpfe immer ein großes Erlebnis. So erinnere ich mich an einen Auftritt von Phil Boggs, der in einer Wettkampfpause den Welt-Erstversuch eines 4 ½ Salto vorwärts gehockt vom 10-m-Turm wagte und erfolgreich absolvierte. In einer weiteren Pause zwischen den Wettkämpfen zeigte er auch noch den 3 ½ Delphinsalto gehockt, ebenfalls von der 10-m-Plattform. So etwas erlebte man eben nur in Rostock. Später wurden weitere Weltneuheiten beim "Springertag" gezeigt, wie z. B. der 3 ½ Auerbachsalto gehechtet, der 2 ½ Salto vorwärts mit drei Schrauben, der 3 ½ Delphinsalto gehechtet (alle vom 3-m-Brett), um nur die wichtigsten zu nennen, die mir wegen ihrer Außergewöhnlichkeit, ihrer Schwierigkeit und Präzision im Gedächtnis geblieben sind. In diesem Zusammenhang ist auch der Wagemut - nach gewissenhafter Vorbereitung natürlich - des Rostocker Springers Frank Sander hervorzuheben, der hier 2003 zum 48. Springertag in Rostock als erster Springer der Welt den 4 ½ Salto vorwärts gehockt vom 3-m-Brett im Wettkampf vorführte. Respekt allen diesen hervorragenden Springerinnen und Springern, die mit ihren Vorstößen die Welt des Wasserspringens bereichert und ihre Entwicklung vorangetrieben haben.

M. D.: Ich kann mich gut daran erinnern, dass du zu den Trainertagungen nach internationalen Wettkampfhöhepunkten wie Olympischen Spielen oder Weltmeisterschaften immer eine Weltstandsanalyse vorgelegt hast. Wie sieht's aus mit den deutschen Wasserspringern? Spielen wir da in den letzten Jahren eine Rolle?
T. K.: Die Auseinandersetzung mit der Weltspitze erfordert im Hochleistungssport in jedem Falle, dass die Tendenzen der Leistungsentwicklung frühzeitig erkannt werden. Das ist eine der Leistungen, die wir, die Kolleginnen und Kollegen des Instituts für Angewandte Trainingswissenschaft in Leipzig, für die Abteilung Wasserspringen im Deutschen Schwimm-Verband seit Jahren, Jahrzehnten mit Akribie erbringen. Daraus lassen sich die Aufgaben für die deutschen Spitzenspringer ebenso aufzeigen, wie es Empfehlungen für das gesamte Ausbildungssystems mit den Praxispartnern zu diskutieren gilt. Wasserspringerinnen und
-springer, die es einmal bis in die höchsten Regionen geschafft haben, und das ist national genauso zu beobachten wie international, bleiben in der Regel auch lange da. Aktuell gibt es in Deutschland sehr gute Wasserspringerinnen und Wasserspringer im Spitzenbereich, wovon die Ergebnisse bei den letzten Olympischen Spielen in Paris zeugen. Aber auch im Nachwuchsbereich sind eine ganze Reihe von Springerinnen und Springern bei den Jugendweltmeisterschaften im letzten Jahr in Rio de Janeiro mit hervorragenden Leistungen aufgefallen. Zu Beginn eines neuen Olympiazyklus gibt es immer Fluktuationen, ältere Sportler beenden ihre Karriere, jüngere wollen ihren Platz in der Nationalmannschaft einnehmen. Die momentane Situation im deutschen Wasserspringen trägt dem Rechnung und mir ist überhaupt nicht Bange, dass die erfolgreiche Tradition des deutschen Wasserspringens bei den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles und auch darüber hinaus fortgesetzt werden wird.
ERROR: Content Element with uid "3788" and type "mask_addslider" has no rendering definition!
M. D.: Ich habe als Trainerin und Kampfrichterin von vielen Sportlern wegen ihrer besonderen Art zu springen geschwärmt. Gibt es das bei dir auch oder sind es nur die "nackten" Zahlen und Parameter, die dich begeistern?
T. K.: Zuerst steht eigentlich immer die Begeisterung, die Überraschung, das Schöne, das Erstaunliche. Da wird man stutzig, möchte diese Momente auskosten, kann nicht mit dem Verstand fassen, was daran das Besondere war, was einen an einer Sprungausführung so gefesselt hat. Dieses Besondere möchte man ergründen und so fängt man an, mit seinen Mitteln - bei uns sind dies eben die biomechanischen Bewegungsparameter - nachzuforschen. Das heißt, die "nackten Zahlen" sind letztlich nur das Vehikel der Erkenntnis. Oft reichen die Zahlen der Biomechanik und der Statistik aber nicht, um bestimmte Phänomene zu erklären. Es bleibt immer ein Rest Unbekanntes, Zauberhaftes. Und so kann diese Faszination, wie in meinem Falle, ein Forscherleben lang halten.
ERROR: Content Element with uid "3791" and type "mask_addslider" has no rendering definition!
M. D.: Seit 1982 bei der WM in Ecuador und erst recht seit den Olympischen Spielen 1984 in Los Angeles bestimmen die chinesischen Wasserspringer das Geschehen an der Weltspitze. Als Wissenschaftler hast du dir doch bestimmt im stillen Kämmerlein Gedanken gemacht, warum sie so dominant sind. Lass uns mal teilhaben an deinen Erkenntnissen.
T. K.: Erkenntnisse dazu gibt es wenige, eher punktuelle Beobachtungen. Man muss wissen, dass Wasserspringen in China so populär ist wie in den Vereinigten Staaten Baseball oder American Football oder eben wie bei uns Fußball, Tennis oder die Formel I. Viele, viele junge Menschen trainieren Wasserspringen. Z. B. in Chongqing, der größten Stadt der Welt, sind 2000 Springer in den Hallen und Bädern anzutreffen - haben wir uns sagen lassen -, die wettkampfmäßig Wasserspringen ausüben. Und es gibt viele, viele solche Städte in China - allein 17 sogenannte Megastädte mit 10 Mio. und mehr Einwohnern. Wir hatten die Möglichkeit, in Xi'an bei Nachwuchssportlern eine Woche lang zu hospitieren. Die allgemeine Erkenntnis war damals: Naja, was anderes als wir machen die chinesischen Springer auch nicht - wohl aber mit einer, wie wir beobachtet haben, ruhigen und stressfreien Konsequenz und Zielgerichtetheit, die aufgrund der vielen Konkurrenten im eigenen Land nahezu zwangsläufig zum höchsten internationalen Niveau führt.
M. D.: Was zeichnet aus deiner Sicht den "perfekten" Springer bzw. die "perfekte" Springerin aus?
T. K.: Der perfekte Springer verkörpert ein Höchstmaß an - ich nenne es jetzt - "Springerischer Authentizität". Das soll heißen, dass jeder Mensch natürlich sehr unterschiedlich ist, so auch die Wasserspringer. Wenn beim Wasserspringen die Ausführung eines Sprunges, einer Sprungserie zum Naturell des Springers passt - eine Springerin/ein Springer ist besonders elegant, eine andere/ein anderer besonders schnellkräftig oder athletisch - dann sollte genau das auch in ihrem beziehungsweise seinem Springstil seine Verwirklichung finden. Grundvoraussetzung ist dabei, dass man die hohe Komplexität schwierigster Sprünge mit höchster Präzision beherrscht. Um dahin zu kommen, sind Beharrungsvermögen, Siegeswille, Umgang mit zeitweiser Stagnation und Rückschlägen gute Ratgeber und sollten ständige Begleiter jedes Springers sein.

M. D.: Als Wissenschaftler im Wasserspringen bist du sicher dem Kunst- und Turmspringen gleichermaßen "verpflichtet". Hast du trotzdem eine heimliche Liebe zu der einen oder anderen Disziplin, Sprunggruppe oder Phase im Sprung und wenn ja, warum?
T. K.: Turmspringen ist in den Augen der meisten Zuschauer natürlich spektakulärer als das Springen vom wackeligen Brett. Nicht zuletzt zeugt auch das große Interesse am High-Diving, bei dem Sprünge bei den Damen aus 20 m Höhe und bei den Herren sogar aus 27 m Höhe absolviert werden, davon. Aus der Sicht der Anforderungen an die Springer sieht das genau andersherum aus. Die Abstimmung zwischen dem Springer und dem Brett bedarf einer deutlich größeren Ausbildungszeit bis Weltspitzenniveau erreicht wird. Erst die Harmonie von Springer und Brett ermöglicht es, die vielen Drehungen um die Breitenachse und um die Längenachse - sprich: Salti und Schrauben und ihre Kombination - vom 3-m-Brett in hoher Qualität auszuführen.
M. D.: Was ist deine Hauptaufgabe, wenn du die Athleten und Trainer im Trainingsprozess begleitest?
T. K.: Die Hauptaufgabe besteht darin, die Sportler möglichst zu ihren persönlichen Bestleistungen zu führen, wobei die Trainer naturgemäß in der Verantwortung stehen. Die unterschiedlichen Sichtweisen der Trainer und Wissenschaftler auf den Prozess der Leistungserbringung befruchtet letztlich den Trainingsprozess. Trainer haben immer eine konkrete Sichtweise: d e r Sportler, d e r Sprung, d a s Problem. Die Wissenschaftlersicht ist allgemeiner: theorie- und empiriegeleitet.
Der Anspruch des Wissenschaftlers besteht darin, sein Wissen, seine (Er-)Kenntnisse in eine praxistaugliche Form zu bringen.
Insofern ist "unsere" Trainingswissenschaft eine technologische Wissenschaft. Die Frage ist für uns also weniger, ob sich das runde Rad dreht, sondern vielmehr, wie ich mit dem geringsten Materialeinsatz das Rad optimaler drehen kann. Mit anderen Worten: die grundlegenden Erkenntnisse in den einzelnen Wissenschaftsdisziplinen werden in den sogenannten Mutterwissenschaften generiert: Wie der Muskel zuckt, wie er angesteuert wird, wie die Koordination innerhalb und über die Muskeln hinweg organisiert wird und so weiter und so fort. In unseren Unterstützungen geht es darum, diese Erkenntnisse in die sportliche (Höchst-)Leistung einfließen zu lassen, um letztlich den Sportler dabei zu unterstützen, erfolgreich zu sein. In der Wettkampfsituation werden zunächst, und das ist eher langweilig, Daten gesammelt. Mit Hilfe der Videos und der Wettkampfprotokolle können dann Analysen durchgeführt und so die Entwicklungen in der Welt des Wasserspringens identifiziert werden. Daraus ergeben sich Empfehlungen für Änderungen des Ausbildungssystems, wie es unter den spezifischen Bedingungen in Deutschland existiert. Diese Empfehlungen werden dann in den unterschiedlichen Gremien besprochen und führen im besten Falle zu "winzigen" Veränderungen im langfristigen Leistungsaufbau - vom Finden und Begeistern junger Sportler bis zum Erlernen und Vervollkommnen der Höchstschwierigkeiten.
ERROR: Content Element with uid "3790" and type "mask_addslider" has no rendering definition!
M. D.: Trifft auf Trainingswissenschaftler auch zu, dass sie wie Sportler und Trainer mit Erfolg und Misserfolg zu tun haben? Wenn ja, was war dein größter Erfolg und mit welcher Niederlage musstest du umgehen?
T. K.: Die von dir angesprochenen Kategorien "Erfolg und Misserfolg" treffen natürlich für jeden Menschen zu. Erfolg und Misserfolg sind erstens von den Erwartungen abhängig, mit denen man eine Sache beginnt und durchführt, und zweitens sind sie nur mittelbar von den Leistungen abhängig - sprich: es gibt Bedingungen, die selbst bei großen Leistungen den Erfolg vermissen lassen. Das kennt jeder Sportler. Seine Leistungen sind "grandios" und der "Erfolg" ist nicht der erwartete Rangplatz im Wettbewerb. Andere waren diesmal besser. Als Trainingswissenschaftler ist man unmittelbar mit den Leistungen der Sportler und ihrer Trainer verbunden. Insofern fiebert man bei den großen Wettkämpfen mit, freut sich über das Gelingen jedes Sprunges und ist auch ein wenig Stolz, Mitglied eines großartigen Teams zu sein - ob nun vor Ort oder daheim am Bildschirm.
Das Suchen nach Lösungen ist das eigentliche Anliegen meines Tuns.
Die Aufgaben des Trainingswissenschaftlers sind sehr vielfältig: Wir verfolgen die langfristigen Entwicklungen an der Weltspitze und überlegen uns, mit welchen Mitteln wir Trainer und Sportler im unmittelbaren Prozess der Leistungserbringung unterstützen können - biomechanisch, trainingsmethodisch, technologisch und so weiter. Mit den Erkenntnissen über Entwicklungen der sportlichen Leistung in ihren einzelnen Merkmalen sind wir aber auch zugleich Diskussionspartner bei der Verbesserung des Ausbildungssystems von der Sichtung bis zum höchsten Erfolg. Insofern, um auf die eigentliche Frage zurückzukommen, freue ich mich über die Erfolge unserer Springerinnen und Springer unmittelbar. Das Suchen nach Lösungen auf den unterschiedlichen Feldern der "Wasserspringerei" ist jedoch das eigentliche Anliegen meines eigenen Tuns. Da sind Erfolge keine Jubelereignisse, sondern eher der Beitrag der Wissenschaft zu den "schleichenden" langfristigen Verbesserungen des Ausbildungssystems, das über viele Jahre zu internationalen Erfolgen deutscher Sportler führt.

M. D.: Ist die Zusammenarbeit mit Sportlern und Trainern immer leicht oder prallen Wissenschaft und Praxis auch mal aufeinander?
T. K.: Ich sehe es als einen Auftrag und übliche Praxis der Wissenschaft an, mit neuen Erkenntnissen "Unruhe" zu stiften, und zwar nicht nur mit den eigenen, sondern auch mit Erkenntnissen anderer Wissenschaftler, zum Nachdenken anzuregen und neue Wege zu erkunden, auch wenn sich der Erfolg nicht von heute auf morgen einstellt. Auf der anderen Seite stehen die Trainer mit ihren Sportlern in der Verantwortung, bestmögliche Leistungen vorzubereiten und darzubieten. Das ist ein klassisches Problem, ein dialektischer Widerspruch. Aber nur in der Auseinandersetzung mit diesem Widerspruch kann es Entwicklung geben.
M. D.: Was ist dein wichtigster Tipp für kleine Wasserspringer, um einmal in deiner Weltstandsanalyse aufzutauchen?
T. K.: Wasserspringen ist eine faszinierende Sportart, die im weitesten Sinne Bewegungskultur ist. Letztlich ist bei allem Streben nach dem höchsten Schwierigkeitsgrad die Ästhetik der ausschlaggebende Punkt für den Erfolg. Hier paart sich die besondere Fitness mit dem Erlernen der Beherrschung des eigenen Körpers, wozu auch die mentale Höherentwicklung gehört, zu einer sportlichen Leistung, welche die Zuschauer begeistert und Kampfrichter in Erstaunen versetzt. Dafür ist ein hohes Maß an Beharrlichkeit nötig. Das Streben nach dem Schönen im Springen, das Streben nach höchster Präzision in der Ausführung schon bei den leichtesten Sprüngen wird euch im Zusammenspiel mit der zunehmenden Anzahl an beherrschten Salti und Schrauben die Freude an der springerischen Bewegung erleben lassen und den Weg zum Erfolg ebnen.
M. D.: Danke, dass du uns einen kleinen Einblick in deine wissenschaftliche Tätigkeit und deine persönlichen Gedanken gewährt hast. Letztere sind für Freunde des Wasserspringens auch ohne wissenschaftlichen Beleg interessant.
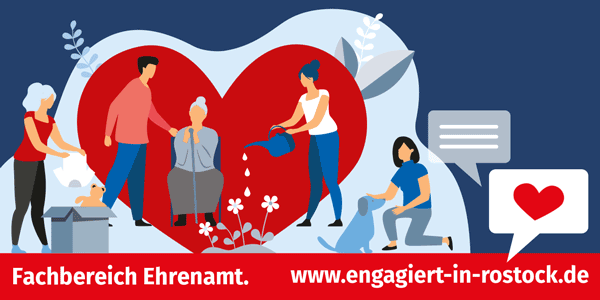
ERROR: Content Element with uid "3797" and type "mask_addslider" has no rendering definition!